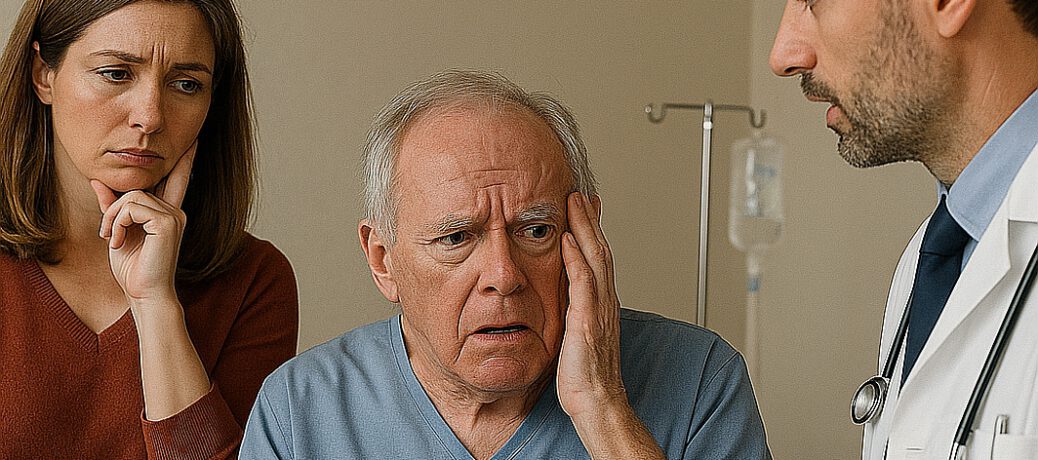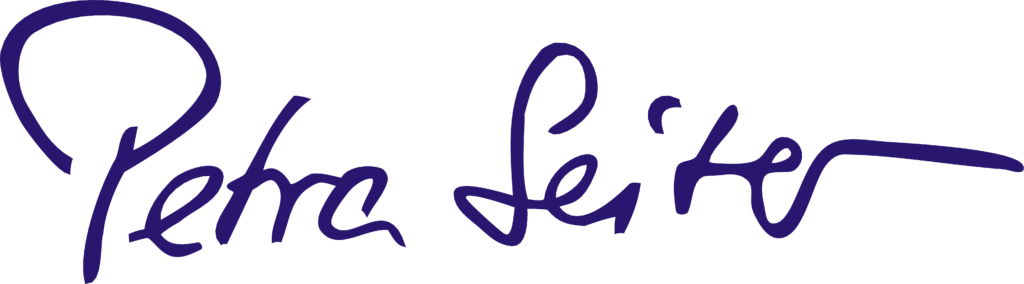Mein Ratgeber für Sie als Angehörige(r)
Glauben Sie auch, dass Ihr älteres Familienmitglied im Krankenhaus eine gute Behandlung erhält? Die Krankenhaus-Statistik des RKI spricht eine andere Sprache: Bei bis zu jeder 10. Behandlung muss man mit Komplikationen rechnen. Personalmangel, schlechte Organisation und Fahrlässigkeit entstehen oft als Folge, weil ein Krankenhaus wirtschaftlich arbeiten muss. Leid, Hilflosigkeit und eine Genesung, die unnötig verzögert wird, sind die Folgen.
Deshalb habe ich als Patientenbegleiterin darüber ein Buch mit allen meinen Erfahrungen geschrieben. Damit Sie als Angehöriger wissen, worauf Sie im Krankenhaus achten müssen und wie Sie Ihre Liebsten erfolgreich unterstützen können.
Ihre
Lesen Sie mehr auf meinen Social-Media Kanälen!
auf Facebook, Instagram, Tik Tok, WhatsApp und Youtube berichte ich regelmäßig über neue Entwicklungen. Zudem stelle ich dabei auch neue oder aktualisierte Urteile vor und gebe Empfehlungen ab. Außerdem finden Sie bei mir Informationen über neue Trends und Entwicklungen. Mehr dazu auch im politischen Gesundheitsblog von Jürgen Loga!
Welche Erfahrungen haben Sie bei dem Aufenthalt im Krankenhaus gemacht? Was haben Sie oder Ihr Angehöriger erlebt? Bitte machen Sie bei der Umfrage mit, denn ich möchte daraus eine große Statistik erstellen, die zeigt, dass es dringend Handlungsbedarf gibt!
Der politische Gesundheitsblog

Jürgen Loga ist nicht nur Herausgeber und Chefredakteur von meinem Buch und dieser Seite, sondern auch freier Journalist, der regelmäßig die aktuelle Entwicklungen im deutschen Gesundheitswesen in Artikeln kommentiert.
Nachfolgend finden Sie seine Einschätzung zu den Themen, die für Sie als Leser meines Buches durchaus eine Rolle spielen!
Artikel von Jürgen Loga
- Fake-Betrug bei der Krankengeschichte für 11 EUR
Fake Diagnosen werden immer öfter aufgedeckt!
Seit Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) melden Medien und Patientenorganisationen vermehrt Fälle, in denen Menschen in ihrer Akte Diagnosen entdecken, die sie nie hatten – teils schwere psychische Erkrankungen. Ausgangspunkt ist die Recherche einer Regionalzeitung (Neue Westfälische), auf die sich WDR, Deutsches Ärzteblatt, Tagesspiegel und andere stützen!
Patienten stoßen jetzt in ihrer ePA auf „Phantomdiagnosen“ oder deutlich übertriebene Befunde, besonders im Bereich psychischer Erkrankungen. Viele haben sich gefragt, wie es zu einer Häufung dieser Fakes kommt. Jetzt wird klar: Ein möglicher Hintergrund ist , dass für bestimmte Diagnosen Kassen und Ärzte höhere Pauschalen abrechnen können – ein Anreizsystem, das „auffällige“ Kodierungen belohnt.
Belastbare bundesweite Zahlen fehlen, die ärztlichen Verbände betonen, man dokumentiere „nach bestem Wissen und Gewissen“ und Fehler seien Einzelfälle. Gleichzeitig berichten Beratungsstellen und Medien von wachsenden Beschwerden, etwa wenn falsche Diagnosen Versicherungsabschlüsse oder Berufswege blockieren.
Und natürlich muss man sich wundern – und kritisieren , dass Ärzte für die Erstbefüllung der ePA pauschal rund 11 Euro pro Patient abrechnen können – bei minimalem Aufwand und kaum kontrollierter Dokumentation. Patientenvertreter fordern deshalb eine unabhängige Prüfstelle für ePA-Einträge, weil die digitale Akte sonst zur Abrechnungsmaschine ohne wirksame Kontrolle verkommt.
Wenn die Fake Diagnose mehr wert ist als der Mensch
Eine falsche Diagnose in der Akte reicht, um eine Berufsunfähigkeits- oder Lebensversicherung zu versauen – und genau das passiert inzwischen nachweislich immer häufiger, seit Patienten überhaupt in ihre elektronische Akte hineinschauen können.
Was sehen wir?
Ein System, in dem dieselben Codes gleichzeitig über Geldströme, Versicherungsrisiken und Berufswege entscheiden – und in dem „kreative“ Diagnosen sich lohnen können. Das ist kein dummer Zufall, das ist ein Konstruktionsfehler mit eingebauter Versuchung. Ein Anreizsystem, bei dem für bestimmte Diagnosen höhere Pauschalen fließen, erzeugt zwangsläufig den Druck, genau diese Diagnosen häufiger zu kodieren.Von einem „Geschäftsmodell“ zu sprechen, ist hart – aber was ist es sonst, wenn falsche oder übertriebene Diagnosen die Einnahmen von Praxen und Krankenkassen steigern können! Das ist ja auch kein Wunder, wenn an allen Ecken gespart wird und so „kreative“ Lösungen genommen werden,,,
Die ärztliche Selbstverwaltung verweist darauf, man kenne keine belastbaren Zahlen und dokumentiere nach bestem Wissen. Gleichzeitig berichten Zeitungen, Patientenberatungen und nun auch das Deutsche Ärzteblatt selbst von „Phantomdiagnosen“, überhöhten Befunden und auffälligen Häufungen bei psychischen Erkrankungen.
Ohne Statistik bleibt ein Rest Unschärfe – aber der strukturelle Interessenkonflikt ist messerscharf sichtbar:
Wer mehr Krankheit dokumentiert, kann mehr abrechnen.11 Euro pauschal für die Erstbefüllung der ePA – oft für wenige Klicks –, dazu morbiditätsorientierte Vergütungssysteme, die schwere oder chronische Diagnosen finanziell attraktiver machen: Das ist ein idealer Nährboden dafür, dass aus Fehlanreizen Geschäftsmodelle werden. Nicht bei allen, nicht bei der Mehrheit. Aber bei genug Akteuren, um echten Schaden anzurichten.
Und der Patient? Der darf sich dann mit Versicherern, Ärzten und Datenlöschung herumschlagen, während niemand wirklich verantwortlich sein will!
Solange diagnoseschreibende Stellen finanziell von möglichst „ergiebigen“ Codes profitieren, bleibt die elektronische Patientenakte ein Risiko: für die Versicherbarkeit, den Beruf, die Reputation – und für das Vertrauen in eine Medizin, die ihren Kodierapparat offensichtlich nicht im Griff hat.
Mein Fazit:
Ohne unabhängige Prüfstelle, harte Sanktionen bei Missbrauch und ein Vergütungssystem, das Gesundheit statt Diagnosefantasie belohnt, bleibt die ePA ein Werkzeug, mit dem aus Papierkrankheiten reale Lebensschäden werden. Patienten sollen „mündig“ sein? Dann gehört zur Mündigkeit auch, jede Diagnose in der Akte konsequent zu kontrollieren, anzufechten und notfalls juristisch anzugreifen. Sonst machen andere mit dem Krankheitsprofil von Menschen weiter Geschäfte.
- Kürzere Klinikaufenthalte: Klingt gut, oder vielleicht doch nicht?
Klinikaufenthalt verkürzt, Sorgen verlängert: Der Preis der gesunkenen Verweildauer
Die Nachricht klingt auf den ersten Blick erfreulich, fast schon wie ein Effizienzsieg des Gesundheitssystems: Die Bundesregierung verkündete am 17. November 2025 in einer Pressemitteilung, dass die durchschnittliche Dauer eines Krankenhausaufenthalts im Jahr 2024 auf 7,1 Tage gesunken sei. Damit setzt sich, wie es in der Mitteilung heißt, der „langfristigen Trend zu kürzeren Verweildauern seit Beginn der Krankenhausstatistik im Jahr 1991 fort“. Damals lag der Wert noch bei stolzen 14,0 Tagen, heute ist er beinahe halbiert.
Eine beeindruckende Zahl.
Doch als medizinischer Journalist muss ich hier die Euphorie dämpfen und eine dringende, wenn auch unbequeme Frage stellen: Wer bezahlt am Ende die Zeche für diese ökonomisch motivierte „Effizienz“?
Die Realität, die hinter dieser Zahl steckt, ist ernüchternd: Eine Verkürzung der Liegezeiten in den Kliniken führt unweigerlich zu einer Verlagerung des Behandlungs- und Pflegeaufwands in den ambulanten Sektor – insbesondere in die häusliche Umgebung. Wenn Patienten im Schnitt nach nur 7,1 Tagen (und in den Hauptfächern wie Innere Medizin nach nur 5,2 Tagen) entlassen werden, ist die Wunde oft noch frisch, die Medikation noch nicht optimal eingestellt, die Genesung noch lange nicht abgeschlossen.
Dieses Modell der „ambulanten Nachsorge durch die Hintertür“ kann nur dann funktionieren, wenn der ambulante Sektor – sprich: Hausärzte, Fachärzte, ambulante Pflegedienste – über ausreichend Personal und Zeit verfügt, um die teils komplexen Nachbehandlungen nahtlos zu übernehmen. Hier liegt jedoch das Kernproblem: Die Ressourcen sind bereits jetzt am Anschlag. Überfüllte Praxen, lange Wartezeiten für Termine und eine chronische Überlastung der niedergelassenen Ärzte verhindern oft die notwendige, zeitintensive Betreuung, die ein frisch entlassener Patient benötigt. Die Lücke zwischen Klinikentlassung und adäquater hausärztlicher Versorgung wird so zu einem gefährlichen Vakuum.
Das System schafft sich selbst ein Dilemma: Es spart Kosten im teuren stationären Bereich, indem es Patienten schneller entlässt, erzeugt aber gleichzeitig einen nicht abfangbaren Mehraufwand im ambulanten Bereich. Dies führt oft zu suboptimalen Genesungsverläufen, vermeidbaren Komplikationen und im schlimmsten Fall zur kostenintensiven Wiederaufnahme in die Klinik.
Was ist die Lösung für Patienten und Angehörige?
Da die Politik offensichtlich diesen Engpass in der ambulanten Ressourcendecke ignoriert, liegt die Verantwortung und der Druck leider oft bei den Angehörigen und den Patienten selbst. Es ist unerlässlich, dass Betroffene und ihre Familienangehörigen im Krankenhausalltag aktiv und wachsam sind.
Fordern Sie absolute Klarheit: Patienten und Angehörige müssen darauf bestehen, dass medizinische Behandlungen in der Klinik als abgeschlossen gelten, bevor die Entlassung erfolgt. Lassen Sie sich nicht einfach mit unvollendeten Diagnosen oder noch zu klärenden Medikationsplänen in den Alltag zum Hausarzt „abschieben“.
Insbesondere bei den kurzen Verweildauern, die in der Pressemitteilung genannt werden (z. B. Innere Medizin mit 5,2 Tagen), ist kritische Nachfrage Pflicht. Nur die Fachbereiche, die per se eine längere Heilungszeit erfordern, wie die Geriatrie mit 15,1 Tagen oder die psychiatrischen Fachabteilungen mit Verweildauern zwischen 24,5 und 46,8 Tagen, bieten hier einen gewissen Puffer. Für die Masse der Behandlungsfälle gilt: Klinik ist für Behandlung, nicht für Stabilisierung.
Die gesunkene Verweildauer mag eine gute Statistik für die Gesundheitsökonomen sein, für die Patienten und ihre pflegenden Angehörigen ist sie jedoch eine wachsende Bürde. Es braucht endlich eine Strategie zur Stärkung der ambulanten ärztlichen Kapazitäten, die proportional zur Verkürzung der Liegezeiten ist. Alles andere ist eine Verlagerung des Problems auf Kosten der Gesundheit.
Doch als medizinischer Journalist muss ich hier die Kehrseite dieser Entwicklung beleuchten: Was auf dem Papier als Effizienzgewinn erscheint, geht in der Realität allzu oft zulasten der häuslichen Pflege und Behandlung der Patienten. Wer früher noch in der Klinik stabilisiert, therapiert und auf die Genesung vorbereitet wurde, wird heute früher entlassen.
Der Haken: Diese Verkürzung ist nur dann vertretbar, wenn die nachstationäre Versorgung – sei es durch ambulante Pflegedienste, spezialisierte Therapeuten oder den Hausarzt – nahtlos und mit ausreichenden Ressourcen funktioniert. Genau hier liegt das Problem. Die Allgemeinmedizin ist bereits am Limit. Es fehlt an Ärzten, Pflegepersonal und Zeit. Wer nach wenigen Tagen aus der Klinik entlassen wird – in Fachabteilungen wie der Inneren Medizin oder Chirurgie beträgt die Verweildauer sogar nur 5,2 bzw. 5,0 Tage –, hat oft noch einen komplexen Behandlungsbedarf, der nicht einfach auf den Schreibtisch des überlasteten Hausarztes verlagert werden darf.
Die Lösung liegt nicht in einer sturen Fixierung auf ökonomische Kennzahlen. Angehörige und Patienten müssen darauf achten und es aktiv einfordern, dass medizinische Behandlungen in der Klinik tatsächlich abgeschlossen und kritische Genesungsphasen überwacht sind, bevor eine Entlassung erfolgt. Es darf keine „Abschiebung“ in den oft chaotischen Alltag und zum überlasteten Hausarzt geben, weil die Klinik ihre Bettenkapazitäten freimachen muss. Erst wenn die ambulanten Strukturen gestärkt sind, kann die verkürzte Verweildauer ein echter Fortschritt sein. Bis dahin
- Notfallreform: Endlich Priorität für echte Akutfälle!
Insider wissen es schon lange, jetzt hat eine Studie es bestätigt: 60 % der Notaufnahme-Besuche enden ambulant, es liegt dann also kein echter Notfall vor. 78 % der Bevölkerung befürworten daher laut AOK eine vorgelagerte Ersteinschätzung. Warum also noch zögern? Wer echte Notfälle zuerst behandelt, rettet Zeit, Nerven – und mit Wahrscheinlichkeit Leben. Und was passiert noch mit dem Missbrauch des Notdienstes? Der kostet Ressourcen, die am Schockraum fehlen. Wir alle wollen nicht, dass unsere Angehörigen im Ernstfall warten müssen, weil Bagatellen den Fluss blockieren!
Die Richtung der Bundesregierung, die gestern bekannt gegeben wurde, stimmt jetzt: Triage vor Ort, Leitstellen-Vernetzung 112/116117, klare Wege für Angehörige.
Fazit: Endlich setzt man die richtigen Prioritäten, stärkt die Ersteinschätzung, schützt Akutpatienten. Angehörige müssen sich darauf verlassen können, dass die Dringlichsten zuerst dran sind. Alles andere ist teuer – in Euro, in Pflegezeit, im schlimmsten Fall im Menschenleben.
- 7 Minuten bis zum Exitus
7–9 Minuten: Ab dann kippt bei Herzstillstand die Überlebenskurve steil nach unten – jede weitere Minute verschlechtert die Prognose signifikant. Und wo bleibt der Rettungsdienst?
Die Tagesschau berichtete unlängst über eine neue Studie zu den Rettungsdiensten. Die stellt fest: In Deutschland gibt es uneinheitliche Leitstellenprozesse, überlastete Notaufnahmen, große regionale Unterschiede. Der Kern ist altbekannt: Die Hilfsfrist variiert je nach Bundesland zwischen ca. 8 und 15 Minuten, teils länger im ländlichen Raum – ein Flickenteppich, der Leben kosten kann.
Und wie so oft passiert immer das Gleiche: Ankündigungen, Verschiebungen. Die überfällige Notfallreform wurde bereits ausgebremst. Und es gibt neue Absichtsbekundungen, aber keine Aktion – während Patientinnen und Patienten warten.
Das hat eine Konsequenz für uns Alle!
Jede verzögerte Einweisung erhöht die Wahrscheinlichkeit für Komplikationen, Reha-Bedarf und Pflegeabhängigkeit. Das verändert unseren Alltag, weil wir als Angehörige mehr Pflege leisten müssen. Im Extremfall sterben unsere Familienmitglieder, im Regelfall werden unsere Familien durch spätere Behandlung zu höheren Pflegerisiken gezwungen!
Ich frage deshalb: Warum fehlt weiterhin eine bundeseinheitliche Steuerung von Rufnummern wie 112/116117, wo bleibt eine klare Triage in Leitstellen und eine verbindliche, einheitlich definierte Hilfsfrist? Warum bestehen Lücken bei Nachtflügen und Telemedizin, obwohl die Evidenz vorliegt?
Machen Sie mit beim Thema Rettungsdienst:
Kontaktieren Sie Ihren direkt gewählten Bundestagsabgeordneten und fordern Sie ihn auf, zu handeln. Eine vollständige Übersicht aller Abgeordneten finden Sie auf der Seite „Abgeordnete“ des Deutschen Bundestags: https://www.bundestag.de/abgeordnete.
Solange Reformen vertagt werden,
zahlen Betroffene und ihre Angehörigen
den Preis – täglich, mitunter endgültig. - Falsch gespart beim KHG
3 Stunden. So viel Zeit verlieren Pflege und Ärzte täglich an Papierkram – Zeit, die am Bett fehlt. [Quelle: bdpk.de). Und jetzt wird ab 2026 noch mehr bei Kliniken gekürzt: Um 1,8 Milliarden EUR. Gleichzeitig müssen wegen dem neuen Krankenhausgesetz KHG 5000 Vollzeitstellen in Deutschland geschaffen werden. Was das für den Alltag im Krankenhaus bedeutet? Weniger Personalzeit, mehr Hektik, mehr Verantwortung für Angehörige: mitdenken, organisieren, da sein. Nicht, weil Teams kein Herz hätten – sondern weil Minuten fehlen.
Die beste Sparidee? Weniger Bürokratie, nicht weniger Pflege. Wenn Formulare, Doppel-Einträge und Prüfrituale schrumpfen, wächst sofort die Zeit für Menschen: Gespräche, Schmerztherapie, Mobilisation. Jede gestrichene Zeile im Formular wird zu einer helfenden Hand am Bett!
Mein 1. Fazit: Spare beim Papier, investiere in Zeit. Und zwar für Patienten und deren Angehörige. Wer Krankenhäuser stärken will, gibt Teams Luft – nicht neue Listen!
Mein 2. Fazit: Patientenbegleiter und vor allem die Anghörige müssen das kompensieren. Wieder einmal. Wie lange noch?
- Was bringt uns Patienten die Reform der Reform ?
17,3 Millionen Behandlungsfälle hatten wir in 2024 – und das Kabinett richtet die Kliniken deshalb neu aus: weg von reinen Fallpauschalen, hin zu Vorhaltefinanzierung und Leistungsgruppen. Das Ziel ist klar: mehr Qualität durch Spezialisierung, transparente Klinikwahl via Bundes-Klinik-Atlas, stabilere Netze – gerade im ländlichen Raum. Doch gelingt Qualität ohne längere Wege?
Kommt das Vorhaltegeld ans Bett oder versickert es im Defizit? Bleibt Pflege messbarer Standard statt Schönwetterkriterium? Nun, zumindest die Richtung stimmt. Denn für Patienten heißt das Vorhaben: Eher „gleich an den richtigen Ort“, weniger Doppeluntersuchungen – und für Angehörige: planbarere Pfade, bessere Vergleichbarkeit. Wenn die Länder jetzt die Qualität durch zuviel Bürokratie nicht verwässern und die Daten, auf die die Entscheidungen getroffen werden, verlässlich sind, dann wird aus einer weiteren Strukturänderung endlich Qualität für die Behandlungen, dann gelingt die Reform der Reform! Ihr Jürgen Loga, freier Journalist